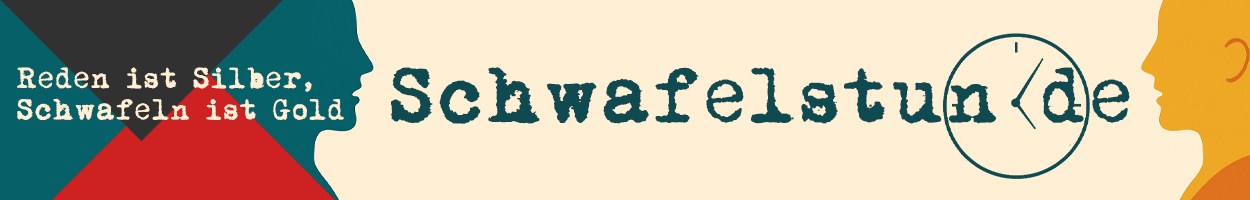Diese Playlist – die ihr auch immer in der aktuellsten Fassung rechts in der Sidebar findet – ist kein klassisches Mixtape, sondern ein Lebenslauf mit Pausenmusik – oder so ähnlich.
Hier landet alles, was mich geprägt, verfolgt, erheitert oder einfach nicht losgelassen hat – der Soundtrack zu den Artikeln, aber auch der Soundtrack zu meinem Leben.
Geboren 1976, also mitten hinein in das Jahrzehnt der Cordhosen, Flokatis und schlecht gealterten Musikvideos. Ein Kind der Achtziger, aufgewachsen zwischen Kaltem Krieg und Formel Eins (die Sendung, nicht der Motorsport). Im elterlichen Plattenschrank standen Reinhard Mey, Elvis, die Bee Gees und Peter Maffay friedlich nebeneinander, während Esther & Abi Ofarim in der Ecke den moralischen Tiefgang hielten.
Dazwischen die ZDF-Hitparade, Bananas und die Piratensender entlang der niederländischen Grenze –
wo zwischen Heino und Hardrock manchmal auch ein Stück Anarchie durchs Rauschen kam.
Musik war immer da – laut, leise, schräg, aber immer ehrlich. Vielleicht höre ich deshalb heute alles, quer durch den Garten, von Valente bis Black Sabbath, von Helge Schneider bis Chet Baker, ohne schlechtes Gewissen und mit offenem Ohr für das Unpassende.
Ich will versuchen, künftig zu jedem Neuzugang auf dieser Playlist einen kleinen Begleitartikel wie diesen zu schreiben – ein paar Zeilen Erinnerung, Haltung, Resonanz und manchmal einfach nur Blödsinn.
Und ich bin ziemlich sicher, dass sich viele Kassetten-Kinder darin wiederfinden werden.
Also: Play drücken.
Der Rest erklärt sich unterwegs.
🎵 „Gut, wieder hier zu sein“ – Mey, Wader & Wecker (Live)
Es gibt Lieder, die klingen wie Heimkommen ohne Navigationsgerät.
Drei Männer, drei Stimmen, drei Jahrzehnte deutsche Geschichte – und ein Refrain, der heute fast trotzig klingt: „Gut, wieder hier zu sein.“
Man könnte meinen, das sei nur Lagerfeuerromantik für Barden mit Bart. Ist es auch. Aber eben ehrliche Romantik. Die Sorte, die nach Rauch riecht und trotzdem etwas taugt.
Nach über zehn Jahren Blog-Pause passt das Lied wie ein freundlicher Schlag auf die Schulter:
„Na, wieder da? Schön blöd, dass du’s noch mal versuchst.“
Und genau deshalb stimmt’s.
Denn Mey, Wader und Wecker haben nie gesungen, um trendy zu sein – sie haben gesungen, um da zu sein.
Das reicht.
Ein Stück Rückkehr, ein musikalisches Schulterzucken, ein kleiner Appell an die Beharrlichkeit:
Man kann vieles verlieren in zehn Jahren, aber den Ton trifft man irgendwann wieder.
🎵 „Meistens ist gar nichts dahinter“ – Mary & Gordy
Ein Lied, das klingt wie ein Augenzwinkern mit Bühnenbeleuchtung.
„Meistens ist gar nichts dahinter“ – das ist Travestie in einem Satz: der große Auftritt, der große Witz, und dahinter… Menschlichkeit.
Mary & Gordy konnten das wie kaum jemand: Glanz zeigen und trotzdem echt bleiben.
Als Kinder haben wir sie geliebt – diese Mischung aus Spaß, Eleganz und leichtem Chaos.
Und wer damals am Fernseher saß, ahnte nicht, dass hinter der Schminke kein Geheimnis steckte, sondern Güte.
Ich weiß es, weil ich es erlebt habe:
Ich habe als Kind einmal bei Reiner Kohler angerufen – einfach so, mit prä-pubertärer Dreistigkeit und ohne Rücksicht auf die elterliche Telefonrechnung – damals gab es noch keine Flatrates und ich sehe schon die Blicke der Jüngeren: Opa erzählt vom Krieg.
Und er hat sich eine Stunde Zeit genommen.
Kein Star-Gehabe, kein Abwimmeln, nur Freundlichkeit und Geduld.
Das war Gordy: ein Clown, der lachen machte, ohne sich über jemanden zu stellen.
Und dieses Lied – harmlos und weise zugleich – bleibt seine kleine Lebensweisheit in Reimform.
Denn ja, meistens ist gar nichts dahinter.
Aber manchmal, ganz selten, ist da alles.
🎵 „She Was Too Good to Me“ – Chet Baker
Manchmal reicht eine Trompete, um alles zu sagen, was man selbst nie hingekriegt hat.
Chet Baker spielt diesen Song, als würde er sich selbst zuhören beim Vergessen.
Kein Pathos, kein Aufschrei – nur dieses seltsame Schweben zwischen Reue und Schönheit.
Für mich hängt an diesem Stück ein Gesicht.
Nicht idealisiert, nicht verklärt – einfach da, in der Erinnerung, wie Rauch im Abendlicht.
„She was too good to me“ – ein Satz, der klingt wie eine Entschuldigung, die man zu spät gefunden hat.
Und trotzdem: kein Drama, keine Wunde, nur ein stilles Nicken.
So klingt es, wenn man versteht, dass manche Menschen bleiben, indem sie gehen.
Baker wusste, dass Romantik keine Pose ist, sondern ein Risiko.
Und jedes Mal, wenn dieser Song läuft, erinnert er mich daran, dass man manche Verluste nicht heilt,
man trägt sie – wie eine Melodie, die zu schön ist, um sie abzuschalten.
🎵 „Girl from the North Country“ – Bob Dylan
Es gibt Stimmen, die nicht singen – sie erzählen, atmen, stolpern, seufzen.
Bob Dylan gehört zu denen, die man nicht mag, weil sie schön klingen, sondern weil sie wahr klingen.
Er heult, er näselt, er nuschelt – und genau darin liegt der Trost.
Man glaubt ihm jedes Wort.
„Girl from the North Country“ ist kein Liebeslied, es ist eine Rückfrage an die Vergangenheit.
Ein Gruß, den man nicht mehr abschickt, weil man weiß, dass er ohnehin ankommt.
Für mich hängt an diesem Song eine Erinnerung, die nicht laut ist.
Eher so ein inneres Kopfnicken: Ja, so war das.
Nicht tragisch, nicht pathetisch – einfach echt.
Und wenn Dylan da sitzt, mit seiner Stimme, die klingt wie Sandpapier über Seide,
dann erinnert er mich daran, dass Perfektion langweilig ist.
Echtheit ist das, was bleibt, wenn die Stimme schon bricht.
🎵 „Daddy“ – Tippaman
Manche Musiker haben kein Management, sondern eine Aura.
Tippaman ist so einer – kein glattproduzierter Typ mit Streamingstrategie, sondern ein echtes Original.
Etwas eigen, ja. Aber wer will schon die Normalverteilung, wenn man Charakter haben kann?
Ich kenne den Tippa seit gut fünfzehn Jahren.
Er hat sogar noch eine meiner Gitarren – was bei anderen ein Verlust wäre, ist bei ihm fast ein Ritterschlag.
Damals, in Porz, gab’s diese legendären Jam Sessions bei einem Arzt (kein Scherz):
Kölsch, Grillduft, und Musik, die nie enden wollte, weil keiner den ersten Akkord vergessen wollte.
Tippaman stand mittendrin, stoned im Takt, irgendwo zwischen Bob Marley, Straßenpoet und Rheinländer.
„Daddy“ klingt genau so: sanft, herzlich, ungehobelt und voll Seele.
Kein Song, der beeindrucken will – einer, der bleibt.
Vielleicht, weil er daran erinnert, dass Musik am besten funktioniert, wenn sie nicht glänzt, sondern lebt und aufrichtig ist.
🎵 „Goodbye My Love, Goodbye“ – Demis Roussos
Es gibt Stimmen, die nicht altern – sie patinieren.
Demis Roussos gehört zu ihnen. Diese Stimme war kein Gesang, das war Geografie: irgendwo zwischen Mittelmeer, Melancholie und Sehnsucht.
Schon als Kind wusste man: Da singt jemand, der alles fühlt, auch das, was man selbst noch gar nicht benennen konnte.
„Goodbye My Love, Goodbye“ – das war nie bloß ein Liebeslied.
Es war Abschied in Operngröße, verpackt in drei Minuten Radiogeschichte.
Bei uns lief das ständig, auf diesen bräunlichen Plattenspielern mit der Zigarettenschale daneben.
Und jedes Mal dachte ich: So klingt Drama, wenn es gute Manieren hat.
Heute höre ich’s und merke: Das Lied war größer als meine Kindheit, aber kleiner als die Erinnerung daran.
Demis Roussos hat die Welt nicht verändert – aber er hat sie für einen Moment lauter gemacht.
Und das reicht völlig.
🎵 „Giftmischerrumba“ – aus „Das Spukschloss im Spessart“ (1960)
Es gibt Songs, die mehr Kino in drei Minuten packen als manch Remake in neunzig.
Der „Giftmischerrumba“ ist so einer: frech, flink, voller Geist – im doppelten Sinn.
Das Lied tänzelt zwischen Morbidität und Mambo, als wüsste sie genau, dass Humor die eleganteste Form von Alchemie ist.
Der Film von 1960 ist einer meiner Lieblingsfilme, und die Rumba ist sein kleines, giftig-glänzendes Kleinod daraus.
Sie erinnert daran, wie charmant deutscher Film sein kann, wenn er Witz und Satire mit Handwerk und Tempo verwechselt – im besten Sinne.
Und genau deshalb habe ich im Blog das Original empfohlen, statt dieses missglückten Sat.1-Remakes „Im Spessart sind die Geister los“: viel Nebel, wenig Geist.
Die alte Rumba hat beides. Sie grinst, sie groovt, sie überlebt jeden Reboot.
Kurz gesagt: Wer verstehen will, warum Nostalgie manchmal recht hat, hört die „Giftmischerrumba“.
Die Hauptache ist der Effekt…
🎵 „Scheener Gigolo“ – Schnuckenack Reinhardt
Manche Musiker spielen nicht, sie erzählen.
Schnuckenack Reinhardt war so einer – ein Mann, der mit seiner Geige ganze Lebensgeschichten in Moll und Dur verwob, ohne ein Wort zu verlieren.
Ich hatte das Glück, ihn mit etwa dreizehn Jahren live zu erleben.
Und ich schwöre: Ich habe damals zum ersten Mal verstanden, dass Musik etwas sein kann, das größer ist als Lautstärke.
„Scheener Gigolo“ ist kein Gassenhauer, sondern pure Eleganz mit leicht gebrochener Haltung – wie ein Gentleman, der zu spät zum eigenen Tanz erscheint.
Reinhardt spielte, als hinge zwischen jedem Ton eine Erinnerung, und das Publikum hörte, als wäre Schweigen plötzlich eine Kunstform.
Für mich war das eine Offenbarung.
Ein Konzert, das mich gelehrt hat, dass Virtuosität nichts mit Tempo zu tun hat, sondern mit Wahrhaftigkeit.
Und dass ein einzelner Bogenstrich manchmal mehr erzählt als hundert Texte.
Heute höre ich das Stück wieder – und sehe diesen Mann vor mir, lächelnd, konzentriert, ganz in seiner Musik.
Einer, der spielte, als wüsste er: Die Geige ist kein Instrument. Sie ist eine Sprache.
🎵 „Versöhnung – Never“ – Schobert & Black
Manchmal ist die hohe Kunst des Kabaretts nichts weiter als das perfekte Spiel mit dem Niedrigen.
Schobert & Black konnten das wie kaum jemand: zwei Herren mit Gitarren, die aus Dialekt und Dada eine ganze Geschichtsstunde zimmerten.
„Versöhnung – Never“ ist kein Lied, das man hört, um sich zu versöhnen.
Es ist ein Meisterstück des höheren Blödsinns – schwarz, böse, hinreißend komisch.
Der ostpreußische Zungenschlag wirkt erst wie Klamauk, entpuppt sich aber als präzise Waffe: eine Parodie auf die eigene Provinz, auf Nationalstolz, auf die sentimentale Erinnerung an ein „Damals“, das nie so unschuldig war, wie man es gern hätte.
Ein Original-Blues ist traurig.
Ein ostpreußischer Blues ist zum Heulen – vor Lachen.
Weil zwischen jedem „Mantje, mantje“ und jeder Reimkatastrophe die ganze Tragikomödie deutscher Nostalgie aufblitzt.
Schobert & Black waren nie nett.
Sie waren ehrlich, scharfzüngig und musikalisch so präzise, dass man ihre Dummheiten fast studieren müsste.
„Versöhnung – Never“ bleibt deshalb ein kleines Denkmal der Aufklärung durch Unsinn.
Und wer jetzt denkt, das sei nur Nonsens – der wird sich wundern.
Dem „höheren Blödsinn“, von Roski bis Insterburg & Co, werde ich bald einen eigenen Artikel widmen.
Weil gute Albernheit zu den letzten ernstzunehmenden Künsten gehört.
🎵 „Die Trompeten von Mexiko“ – Helge Schneider
Helge Schneider ist so ein Fall für sich.
Ein Mann, der gleichzeitig Jazzmusiker, Komiker, Filmemacher und Philosophiepraktikant sein kann – und dabei nicht mal so tut, als müsste das zusammenpassen.
„Die Trompeten von Mexiko“ ist eines dieser Stücke, die zeigen, wie locker Genialität klingen kann, wenn sie keinen Beweis liefern muss.
Ich war sechzehn, als Guten Tach rauskam – da war Helge die Offenbarung und der heiße Scheiß auf dem Schulhof.
Heute, Jahrzehnte später, ist er immer noch derselbe Irrläufer zwischen Improvisation und Irrsinn.
Nur die Trompeten sind etwas voller geworden, der Jazz vielleicht noch freier, der Witz etwas reifer – und das alles, ohne an Leichtigkeit zu verlieren.
Dieses Stück ist kein Song, es ist eine Laune.
Ein Spaziergang durch ein musikalisches Gehirn, das seine Pointen lieber spielt als erklärt.
Und während andere sich fragen, ob das jetzt ernst gemeint ist, weiß Helge längst:
Im Zweifel immer ja – aber bitte mit Trompete.